Verschattung kann den Ertrag einer Photovoltaikanlage deutlich verringern, selbst wenn nur einzelne Module betroffen sind. Besonders im Winter entstehen durch den tieferen Sonnenstand längere Schatten, die große Teile der Photovoltaikanlage beeinträchtigen. Aus diesem Grund ist es wichtig, bereits bei der Planung der PV-Anlage mögliche Verschattungsquellen zu erkennen und gezielt zu vermeiden.
Dieser Beitrag zeigt, wie Verschattung entsteht, welche Folgen sie auf den Ertrag der Anlage hat, welche technischen Lösungen helfen und worauf bei der Standortwahl und Planung zu achten ist.
Was bedeutet Verschattung bei Photovoltaikanlagen?
Verschattung bei Photovoltaikanlagen bedeutet, dass Solarmodule durch Objekte wie Gebäude, Bäume, Schornsteine, Antennen, Laub, Schmutz oder Schnee vom Sonnenlicht abgeschirmt werden. Dadurch sinkt die Einstrahlung, was den Stromertrag mindert.
Photovoltaikmodule bestehen aus Solarzellen, die in Reihe geschaltet sind. Wird eine Zelle verschattet, wirkt sie wie ein Widerstand und bremst den Stromfluss im Modul oder Strang. Das senkt den Wirkungsgrad und kann Hot Spots verursachen. Hot Spots sind Überhitzungen, die Zellen dauerhaft schädigen.
Wie entsteht Verschattung bei PV-Anlagen?
Verschattung bei PV-Anlagen entsteht, wenn Objekte wie Gebäude, Bäume oder Blätter das Sonnenlicht blockieren und Modulflächen abdunkeln. Im Unterschied zur Abschwächung durch Bewölkung, bei der diffuse Einstrahlung vorliegt, handelt es sich bei Verschattung um eine feste Lichtbarriere. Sie verursacht ungleichmäßige Lichtverteilung und stört den Stromfluss in den Solarzellen.
Selbst kleine Blockaden erzeugen Widerstände im Zellverbund und senken den Energieertrag. Ursachen liegen oft in der Umgebung der Anlage, etwa durch Baukörper, Vegetation oder Schmutz.
Während diffuse Einstrahlung bei wechselhaftem Wetter kurzzeitig ist, verursacht Verschattung langanhaltende Leistungseinbußen.
Wie wirkt sich Verschattung auf den Photovoltaik-Ertrag aus?
Verschattung mindert den Photovoltaik-Ertrag, weil einzelne abgedunkelte Solarzellen den Stromfluss im Modul und im Modulstrang begrenzen. Der Leistungsverlust ist überproportional, da Solarzellen in Serie verschaltet sind und verschattete Zellen hohen Widerstand erzeugen. Dadurch sinkt der Stromfluss nicht nur lokal, sondern im gesamten Abschnitt.
In kritischen Fällen entstehen Hot Spots, die die Modulstruktur beschädigen. Moderne Module nutzen Bypassdioden, um verschattete Zellen zu überbrücken und Leistungsverluste zu begrenzen. Diese verhindern Überhitzung, kompensieren aber keine dauerhaften Abschattungen.
Da auch Solarmodule in Reihe geschaltet sind, überträgt sich der Effekt einzelner Verschattungen auf den Modulstrang. Ein kleiner Schatten kann den Ertrag der gesamten Anlage spürbar senken.
Welche Ursachen sorgen für Verschattung bei PV-Anlagen?
Verschattung bei PV-Anlagen entsteht durch feste Objekte, Ablagerungen oder ungeeignete Modulstellungen, die den Lichteinfall auf einzelne Solarzellen oder ganze Modulflächen verhindern. Die folgenden Ursachen beeinflussen die Verschattung und den solaren Energieertrag.
- Gebäude
- Bäume
- Dachaufbauten
- Topografie
- Strominfrastruktur
- Vegetation und urbane Elemente
- Schmutz, Schnee, Laub, Vogelkot
- Modulanordnung bei Flachdächern und Freiflächen
- Gebäude: Nachbarhäuser oder angrenzende Bauwerke werfen je nach Sonnenstand dauerhafte oder zeitweise Schatten auf die PV-Module. Besonders problematisch sind hohe Baukörper im Osten oder Westen.
- Bäume: In der Nähe wachsende Bäume verursachen durch Äste, Stamm und Blattwerk variable Schattenwürfe. Im Herbst kann zusätzlich Laub auf den Modulen liegen bleiben und den Ertrag mindern.
- Dachaufbauten: Schornsteine, Gauben, Lüftungsrohre oder Satellitenschüsseln erzeugen bewegliche Verschattungen. Der Verlauf dieser Schatten ändert sich mit der Tageszeit und führt oft zu Ertragseinbußen auf Zellniveau.
- Topografie: Erhebungen wie Hügel, Geländekanten oder Berge verschatten die Anlage insbesondere morgens und abends. Der Einfluss ist abhängig von der Modulneigung und Ausrichtung.
- Strominfrastruktur: Strommasten, Leitungen und Blitzableiter werfen teils punktuelle, teils linienförmige Schatten. Einzelne verschattete Zellen können dabei den Stromfluss des gesamten Moduls beeinträchtigen.
- Vegetation und urbane Elemente: Zäune, Hecken oder Straßenlaternen wirken sich bei tiefem Sonnenstand negativ aus. Besonders bei Ost-West-Ausrichtungen können diese Objekte regelmäßig Schatten werfen.
- Schmutz, Schnee, Laub, Vogelkot: Temporäre Abschattungen entstehen durch Ablagerungen auf der Moduloberfläche. Diese verursachen ungleichmäßige Bestrahlung, reduzieren den Wirkungsgrad und fördern Hot Spots.
- Modulanordnung bei Flachdächern und Freiflächen: Bei zu geringer Reihenabstand oder zu steilem Neigungswinkel verschatten sich die Module gegenseitig. Der Effekt verstärkt sich im Winter bei tiefem Sonnenstand. Eine optimierte Aufstellung verhindert Eigenverschattung und steigert die Effizienz.
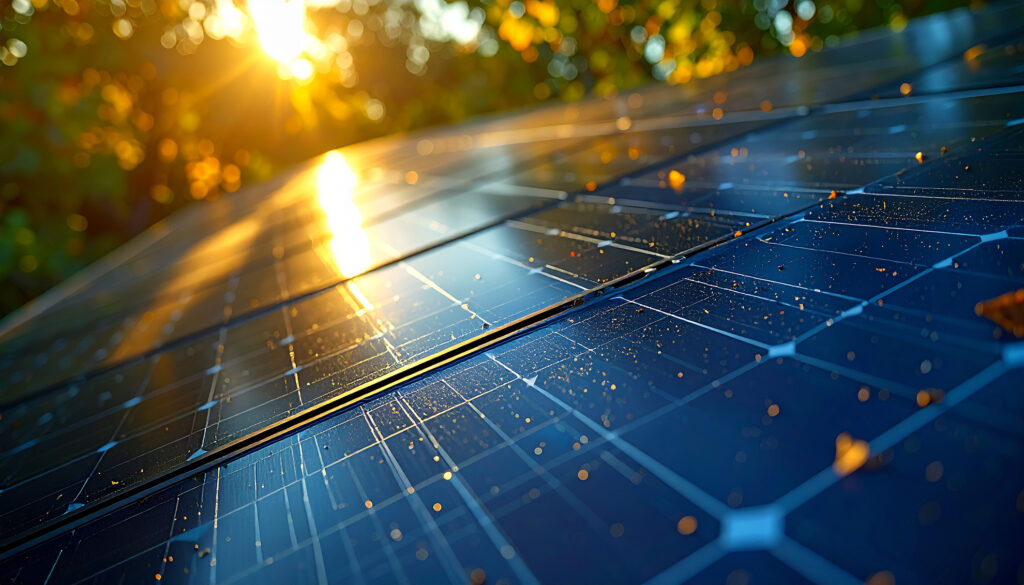
Wie lässt sich Verschattung bei der Planung der Photovoltaikanlage vermeiden?
Verschattung bei der Planung einer Photovoltaikanlage lässt sich vermeiden, indem eine präzise Verschattungsanalyse durchgeführt und alle Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Dazu zählen Objekte wie Bäume, Gebäude oder Geländestrukturen sowie mögliche Veränderungen durch Baumaßnahmen oder Pflanzenwachstum.
Solarteure analysieren den Standort zusammen mit dem Sonnenstand zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten, um Schattenwürfe vorherzusehen. Hilfsmittel wie Sonnenbahn-Indikatoren oder digitale Messgeräte zeigen potenzielle Verschattungen am Installationsort. Ergänzende Softwaremodelle liefern Prognosen, erfordern jedoch Fachwissen.
Besonders relevant ist der Sonnenstand im Winter, da tiefstehende Sonne längere Schatten erzeugt. Für Laien ist die Bewertung dieser Parameter komplex. Der Einsatz erfahrener Fachplaner minimiert Ertragseinbußen durch Verschattung von Beginn an.
Welche technischen Lösungen gibt es, um die Auswirkungen von Verschattung zu minimieren?
Die Auswirkungen von Verschattung auf den Ertrag von PV-Anlagen lassen sich durch gezielte technische Maßnahmen deutlich reduzieren. Die folgenden Lösungen adressieren Schwachstellen auf Zellen-, Modul- und Systemebene.
- Bypass-Dioden
- Leistungsoptimierer
- Mikrowechselrichter
- Dünnschichtmodule
- Hot-Spot-resistente Module
- Segmentierte Verschaltung
- Parallelschaltung
- Verschattungsanalyse
- Reinigung und Wartung
- Bypass-Dioden: Umgehen verschattete Zellbereiche durch elektrische Überbrückung. Jedes Modul enthält meist drei Dioden, die es in Zonen unterteilen. Das verhindert Leistungseinbrüche und reduziert Hot-Spots um bis zu 90 Prozent.
- Leistungsoptimierer: Optimieren den Stromfluss jedes Moduls separat. Verschattete Module beeinflussen nicht den gesamten Strang. Der Ertrag bei Teilverschattung steigt dadurch um 25 bis 40 Prozent.
- Mikrowechselrichter: Wandeln Gleichstrom modulweise in Wechselstrom um. Jede Einheit arbeitet unabhängig, wodurch Verschattungen nur lokal wirken. Die Gesamtleistung bleibt stabil.
- Dünnschichtmodule: Reagieren weniger empfindlich auf ungleichmäßige Lichtverhältnisse als kristalline Module. Eignen sich besonders für Dächer mit wechselnder oder diffuser Einstrahlung.
- Hot-Spot-resistente Module: Verfügen über integrierte Schaltungen, die Leistungsverluste bei Teilverschattung auf unter drei Prozent begrenzen. Bieten thermische Sicherheit und konstante Energieausbeute.
- Segmentierte Verschaltung: Gruppiert Module mit ähnlicher Einstrahlung in eigene Strings. So werden Schattenwirkungen auf bestimmte Modulbereiche isoliert.
- Parallelschaltung: Vermeidet serielle Abhängigkeit. Verschattete Module beeinträchtigen nicht den Stromfluss der gesamten Reihe.
- Verschattungsanalyse: Prognostiziert mit Sonnenverlaufsdaten potenzielle Schattenquellen wie Bäume oder Schornsteine. Optimiert die Positionierung der Module im Vorfeld.
- Reinigung und Wartung: Entfernt temporäre Verschattungen durch Laub, Schnee oder Verschmutzungen. Sichert dauerhaft gleichmäßige Einstrahlung.
Sollte man eine Verschattungsanalyse vor der Installation der Photovoltaikanlage durchführen?
Ja, eine Verschattungsanalyse sollte vor der Installation einer Photovoltaikanlage zwingend durchgeführt werden, da selbst geringe Schattenwürfe den Ertrag der gesamten Anlage deutlich reduzieren können. Bereits einzelne Objekte wie Bäume, Nachbargebäude oder Schornsteine erzeugen je nach Sonnenstand kritische Abschattungen, die den Stromfluss im Modulstrang beeinträchtigen.
Mithilfe von 3D-Modellen und Schattensimulationssoftware lassen sich potenzielle Verschattungsquellen präzise erfassen und bewerten. Dabei werden tages- und jahreszeitliche Lichtverhältnisse berücksichtigt, um saisonale Effekte sichtbar zu machen.
Die Verschattungsanalyse ermöglicht eine optimierte Modulplatzierung und gezielte Ausrichtung, um lichtschwache Bereiche zu vermeiden oder mit Leistungsoptimierern auszugleichen.
Welche Solarmodule reagieren weniger Empfindlich auf Verschattung?
Dünnschichtmodule reagieren weniger empfindlich auf Verschattung als klassische kristalline Solarmodule. Die folgenden Modultypen und Technologien zeigen eine erhöhte Toleranz gegenüber Teilabschattung und diffusem Licht.
- Dünnschichtmodule
- Module mit optimiertem Zelldesign
- Systeme mit Mikro-Wechselrichtern
- Dünnschichtmodule: Diese bestehen meist aus Cadmiumtellurid oder amorphem Silizium. Ihr Aufbau erlaubt eine gleichmäßigere Stromverteilung. Sie liefern bei teilweiser Verschattung oder diffuser Einstrahlung vergleichsweise stabile Erträge. Im Gegensatz zu monokristallinen Modulen zeigen sie unter Schatteneinfluss geringere Leistungsverluste.
- Module mit optimiertem Zelldesign: Durch veränderte Zellverschaltung und kleinere Zellsegmente wird der Stromfluss flexibler. Verschattete Bereiche blockieren nicht mehr das gesamte Modul, wodurch der Energieertrag konstant bleibt.
- Mikro-Wechselrichter: Jedes Modul besitzt einen eigenen Wechselrichter. So kann es unabhängig von anderen Modulen arbeiten. Verschattung auf einem Modul beeinflusst nicht die Leistung des gesamten Systems.
Wie wirkt sich der tiefere Sonnenstand im Winter auf die Verschattung einer Photovoltaikanlage aus?
Der tiefere Sonnenstand im Winter vergrößert die Verschattung einer Photovoltaikanlage, da die Sonnenstrahlen in einem flacheren Winkel auf die Modulfläche treffen und dadurch längere Schatten erzeugen. Objekte wie Bäume, Nachbargebäude oder Dachaufbauten werfen bei tiefem Sonnenstand deutlich ausgedehntere Schattenzonen als im Sommer. Ein Baum, der im Sommer kaum relevant ist, kann im Winter große Modulbereiche verdunkeln.
Diese saisonalen Lichtverhältnisse führen häufig zu deutlich geringeren Erträgen in den kalten Monaten. Deshalb ist es wichtig, bei der Planung auch jene Besonderheiten zu berücksichtigen, die für den Betrieb einer Solaranlage im Winter entscheidend sind – etwa veränderte Einstrahlungswinkel, Schneelasten oder die allgemein reduzierte Tageslichtdauer.


